... in Einzelanfertigung
sodass ein proportioniertes Größenverhältnis zwischen Brille und Gesicht gewährleistet ist.

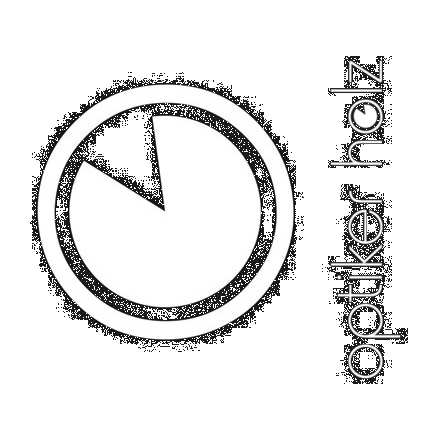
Ein Tipp für Brillenliebhaber und Menschen mit hohen Sehansprüchen ist der augenoptische Fachbetrieb in der ehemaligen Synagoge von Boppard.
Hier wird weit mehr als nur anspruchsvolle und individuelle Augenoptik, zu moderaten, fairen und ehrlichen Preisen, erlebnisvoll angeboten.
Di. Mi. Do. Fr. 10.00 - 13.00 + 14.00 - 18.00 / Sa. 10.00 - 13.00 / Montags Ruhetag